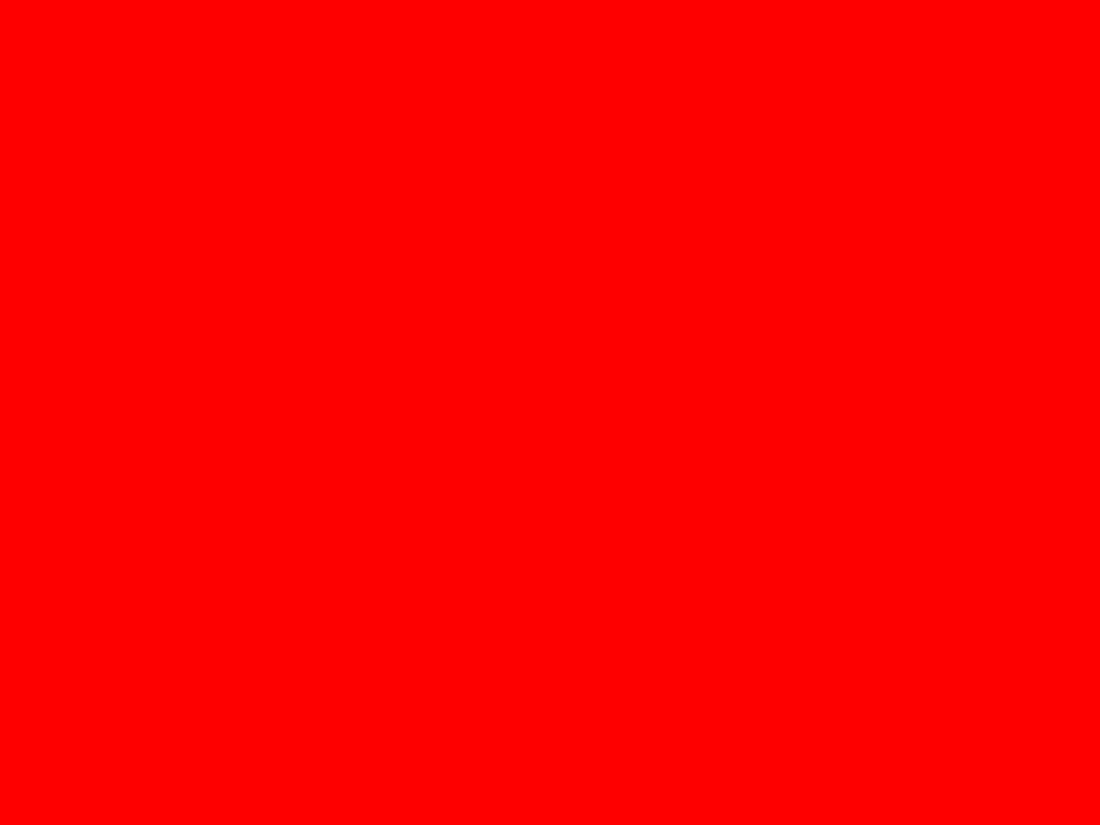30 % aller Beschäftigten in der Pflege denken darüber nach, aus dem Beruf auszusteigen. In Deutschland hat das Phänomen einen Namen: Pflexit. Exit aus der Pflege.
Viele sind sich einerseits unsicher, was sie danach machen sollen, aus vielen Kommentaren aber lese ich auch, dass sich auch Berufsfremde nicht vorstellen können, dass Pflegende zu irgendwas anderem in der Lage sein sollen, als zu pflegen.
Sicher, es gibt diese klassischen Austeigemodelle, MDK, PDL, Referent. Doch es gibt ja auch ganz andere Möglichkeiten, auf dem, was man hat, aufzubauen.
Ich bin letztlich eines davon. Nach dem Studium der Geschichte/Kunstgeschichte und Archäologie bin ich nun in der Medizingeschichte tätig und beäuge das Gesundheitssystem aus einem anderen Blickwinkel.
Eine andere Kollegin von mir, Katharina, hat hingegen einen Pflexit XTREME hingelegt. Weil sie die Menschen einfach nicht so versorgen konnte, wie sie es gerne gewollt hätte, stieg sie aus, lebte im Coronajahr 1 in Kolumbien im Dschungel (!!), arbeitet als Künstlerin und wandte sich alternativer Heilung zu.
Einen Mittelweg zwischen Theorie und völliger Umdeutung hingegen hat Astrid hingelegt. Warum das passiert ist, wie sie ihre neue Leidenschaft entdeckt hat und was sich nun geändert hat, erzählt sie uns hier.
„Ich stand gegen 2 Uhr morgens vor der Tür des psychiatrischen Wohnheims, in dem ich seit einem Jahr als Dauernachtwache arbeitete. Hinter mir die komplett manische Patientin, die ganz ihrer Erkrankung gemäß seit Tagen nicht geschlafen hatte, aufgekratzt durch die Straßen zog, laut schimpfend die Zimmer ihrer Mitbewohner durchpflügte und alles an sich nahm, was nicht niet-und nagelfest war. Ich hatte sie gehindert, einen ganzen Trolley voll gläserner Pfandflaschen, die sie aus diversen Zimmern im Heim zusammengesammelt hatte, mit zu nehmen um sie in einem nahen Supermarkt, dessen Pfandautomat 23 Stunden lang zugänglich war, zu entsorgen und das daraus entstammende Geld an sich zu nehmen. Die Flaschen gehörten dem Heim, was meine Patientin da tat, war schlicht Diebstahl, und es lag in meinem Aufgabenbereich, das zu verhindern. Nach viel hin und her hatte sie schließlich eingelenkt und erlaubt, dass ich ihren Trolley mit den Glasflaschen wieder mit reinnehmen konnte.
Während unserer Debatte war die Haustür zu gefallen. Ich griff nach meinem Schlüssel, um aufzuschließen. Er fiel mir runter. Ich bückte mich, um ihn aufzuheben, und aus irgendeinem Grund wich ich beim Aufheben seitlich aus. Ich weiß bis heute nicht warum, aber es war mein Glück: als ich mich ganz aufrichtete und mich dabei umdrehte, stand Frau M. mit einer zum Schlag erhobenen Glasflasche vor mir. Weil sie sich ertappt fühlte, ließ sie die Flasche gleich wieder sinken, und mir passierte nichts. Ich war auch so perplex, dass ich gar nicht weiter über die Situation nachdachte. Dem Frühdienst übergab ich das Ereignis, und selbstverständlich dokumentierte ich es auch, mit der Bitte, die Heimleitung möge sich mit Frau M. auseinandersetzen. Am nächsten Abend ging ich wieder zur Arbeit. 6 Monate später ließ ich mich in einem KH stationär psychiatrisch aufnehmen. Meine ohnehin vorhandene endogene Depression hatte sich so verstärkt, dass ich meinen normalen Alltag nicht mehr schaffen konnte. Ich blieb 4 Wochen. Danach kündigte ich.
Heute arbeite ich in einer Praxisgemeinschaft für Menschen mit Drogenkonsum. Wie ich hier gelandet bin? Ich habe 2019 das Masterstudium „Tropical Medicine and International Health“ begonnen und dort den Dozenten getroffen, der meine Masterarbeit betreuen wird, und mich hier her geholt hat. Ich weiß nicht, ob es an meiner anderen Stellung zum Chef liegt, aber ich habe hier (nicht zum allerersten Mal, aber es kam selten vor, dass es mir auffiel) endlich das Gefühl: „Hey, da sind Leute echt richtig froh, dass ich da bin! Die finden es richtig geil, dass ich weiß, was ich weiß, und die wollen wirklich wissen, wenn ich eine weitere Befähigung habe, und darauf auch zugreifen, die wollen auch mehr wissen.“ Natürlich ist die Arbeit mit Drogenkonsumenten im ambulanten Bereich weniger körperlich belastend, und ja, das ist ein angenehmer Teil der Arbeit. Die psychische Anstrengung ist aber eine ganz andere. Das muss man können und mögen. Beides ist bei mir der Fall. Wie fast überall im psychiatrischen Bereich liegt viel verborgen in der Kommunikation, sei sie verbal oder nonverbal. Die hier beteiligten Ärzte sehen ihre Patienten mitunter nur alle paar Wochen. Weil wir aus der Pflege (und die MFA-Kolleginnen) hier die sogenannte „Vergabe“, also die Ausgabe der Substitutionsmedikation machen und viele Patienten täglich oder wöchentlich kommen müssen, sehen wir sie deutlich häufiger, wir sind näher dran. Das ist an sich kein Unterschied zum Krankenhaus, denn auch dort ist Pflege näher am Patienten dran als Medizin. Der Unterschied: wenn wir weitergeben, dass uns ein Patient im Verhalten oder im Äußeren auffällig verändert erscheint, dann wird uns regelmäßig rückgemeldet, dass das wichtig ist. Wir haben als Pflege was zu sagen und wir finden Gehör. Mein Gehalt ist besser, ich habe keine Schichten wir im Krankenhaus, vor allem keine Nachtdienste. Wochenenddienste gibt es, aber höchstens einen im Monat.
Ich habe hier auch mit Hierarchien zu tun, und das mag ich hier genauso wenig wie im Krankenhaus. Der Unterschied ist, ich kann das ansprechen, und – vielleicht der größte Unterschied – es wird ernst genommen. Ich werde gefragt. Und es wird mir zugehört.
Studium
(Pflege war noch nie meine Berufung. Als ich noch sehr jung war, wollte ich, wie so viele junge Frauen, Schauspielerin werden. Meine Eltern hatten nicht genug Geld, als dass sie mir ein Leben plus Studium hätten finanzieren können, und Pflege war in meiner Familie immer präsent: meine Großmutter war Pflegehelferin, meine Tante langjährige Psychiatriepflegefachkraft, die zweite Frau meines Vaters Pflegefachfrau. Der Schritt in die Pflegeausbildung war einfach, und der Plan war, dass mir ein Teilzeitjob in der Pflege ein Schauspielstudium finanzieren sollte. Im Nachhinein bin ich froh, dass aus der Schauspielerei nichts wurde; ich fand andere Themen, die mich faszinierten, die ich studieren wollte, und die mir die Pflege finanzierte. Dafür bin ich dankbar. Pflege ist mein langjähriger Brotberuf, und das ist okay. Es gibt schlechtere Jobs, jedenfalls, wenn man sie so ausführen kann, wie man sie eigentlich gelernt hat.)
Seit zwei Jahren studiere ich Tropenmedizin und internationale Gesundheit im Master an der Charité. Ich wollte schon immer meinen Horizont erweitern, auch in der Pflege (vielleicht gerade in der Pflege), und die üblichen Fachweiterbildungen haben mich nie so sehr angesprochen, weil sie mir den Fokus immer weiter zu verengen schienen, anstatt die Perspektive zu erweitern. Das Masterprogramm gibt mir die Möglichkeit, mit Kommiliton:innen aus der ganzen Welt und mit den unterschiedlichsten Hintergründen Erfahrungen auszutauschen, mehr über die verschiedenen Gesundheitssysteme und ihre jeweiligen Vorteile und Schwierigkeiten zu erfahren, und – ganz wichtig – meine Position als Pflegefachfrau vor einem globalen Hintergrund einzuordnen. Meine Kommiliton:innen kommen aus Brasilien, Indien, Aserbaidschan, Kenia, Nigeria, Taiwan, Frankreich, den USA, Ägypten, Australien, Syrien, Kolumbien. Sie sind Ärzt:innen, Physiotherapeut:innen, Pflegefachfrauen, Pharmazeut::innen, Zahnärzt::innen. Unterrichts- und Umgangssprache ist Englisch. Uns allen gemeinsam ist der unbedingte Wille, neues zu lernen, das Gelernte in die Praxis zu überführen und sowohl gemeinsam (wo es sich ergibt) als auch jeder für sich (zB im Heimatland) dafür zu sorgen, dass evidenzbasierter medizinisch-pflegerischer Fortschritt und Wissen ein noch festeres Standbein haben können als bisher schon.
Das Studium begann mit einem dreimonatigen Grundkurs, in dem wir täglich unter der Woche von 9 bis 16 Uhr (prä-Corona) Präsenzunterricht hatten. Aufgeteilt waren diese drei Monate in drei Themenblöcke à ca. 4 Wochen: Medizin-Anthropologie und Epidemiologie, Gesundheitsproblematiken und Labor, und Gesundheitssysteme und politik. Zum Abschluss jedes Blocks gab es eine Klausur, und zum Abschluss der drei Monate (der „Core Kurs“) eine mündliche Prüfung über alle drei Blöcke im Mix. Ich habe ganz ehrlich noch nie so viel so intensiv für eine Universitätsgeschichte geackert – meist war ich nach dem Unterricht noch in der Bibliothek, um Dinge nachzulesen oder vorzubereiten, die Wochenenden saß ich in einer anderen Bibliothek, um auf dem Stand zu bleiben und Klausurstoff einzupauken, zwischendrin begann ich, auf Englisch zu träumen, und gegen Ende der drei Monate war ich, wie die Kommiliton:innen auch, am Rande des Nervenzusammenbruchs. Trotzdem habe ich es sehr geliebt, ich habe dermaßen viel gelernt, und hatte verboten viel Spaß. Es gab Zeiten, da konnte ich zwölf verschiedene Fadenwürmer aus dem Stand herunterbeten, ich erkannte das Ultraschallbild einer tanzenden Wurmlarve in einer Leberverkapselung selbst bei halb geschlossenen Augen, und ganz sicher werde ich nie mehr in meinem Leben barfuß über Sand laufen, oder in tropischen Gewässern schwimmen. Das Gute an dieser Tour de Force: der Lehr- und Werbespruch, „Ivermectin macht alles hin“ wird mir bis mindestens zum Renteneintritt ein Go-To zur Parasitenbehandlung von allem Möglichen im Gedächtnis bleiben.
In diesen drei Monaten habe ich auch den Betreuer meiner Masterarbeit kennen gelernt, in dessen Praxis ich jetzt arbeite, und der sich lt. eigener Aussage geehrt fühlt, dass ich ihn als Betreuer gewählt habe. Hand aufs Herz: von welchem Mediziner habt Ihr, Kolleg:innen, schon mal gehört, dass er sich geehrt fühlt, weil Ihr mit ihm arbeiten wollt?
Pflexit: Ich bin mittlerweile unsicher, ob ich mich als Pflexiter betrachten soll. Meine Arbeit dreht sich ja weiterhin um Medizin und Patienten, nur nicht mehr am Bett. Ich schreibe meine Masterarbeit über psychedelische/psycholytische Therapieansätze zur Drogenentwöhnung mit halluzinogenen Substanzen. Dieser Bereich der Suchttherapie bringt mich realistischerweise weniger mit Kolleg:innen als mit Ärzt::innen in Kontakt, das ist mir bewusst. Aber es ist mir wichtig, dass ich diesen Ansatz auch aus einer spezifisch pflegerischen Sicht betrachte – medizinisch-pharmazeutisch gibt es dafür bereits ausreichend Menschen, die sich um das Thema kümmern. Aus pflegerischer Perspektive nicht. Aber auch Pflegefachpersonen werden über kurz oder lang mit dieser Art von Therapie konfrontiert werden, und wir brauchen Handlungsleitlinien, welche Besonderheiten im Umgang mit genau dieser Therapieform wir für unsere Profession beachten müssen. Und so ist Pflege, auch wenn sie nicht meine Leidenschaft war, doch zu einem zentralen und wichtigen Thema in meinem Leben geworden. Durch den Ausstieg aus der Pflege am Bett wiederum (der sich über mehrere Phasen zog, mit Ausflügen in telefonbasierte Patientenbegleitprogramme, eine Flüchtlingsunterkunft, und eine Corona-Untersuchungsstelle) habe ich mich befreit aus der oft so giftigen Arbeitsumgebung, die Pflege so oft mit sich bringt. Durch eine Stelle in der Leiharbeit habe ich gespürt, wie wenig ich die ungesunden Teamdynamiken, die in der Pflege gang und gebe sind, vermisse. Ich möchte nicht mehr in Teams eingebunden sein, die so unreflektiert über ihre Dynamiken und den daraus entstehenden Konflikten sind, und die darüber hinaus Reflexion darüber als unnötig oder, schlimmer noch, als bedrohlich empfinden. Ich möchte auch nicht mehr mit Kolleg:innen arbeiten, die das Streben nach Horizonterweiterung ( sprich: Bildung) lächerlich machen und die in einem ewigen „hamwa schon immer so gemacht“ ihre Jahre bis zur Rente abreißen. Ich habe einfach keine Lust mehr, Kolleg:innen erklären zu müssen, dass lebenslanges Lernen kein absurdes, lebensfremdes Theoriekonstrukt ist, sondern dass es das aufregendste, befriedigendste ist, was ein so vielfältiger Job wie Pflege zu bieten hat. Ich möchte mich auch nicht mehr mit hochnäsigen Medizinern auseinandersetzen, die „Schwestern“ als bloßen Assistenzberuf unter ihrer Weisungsbefugnis ansehen. Dass wir eine eigene Profession auf Augenhöhe mit den Medizinern sind, hat sic“h nach wie vor nicht weit genug herum gesprochen, und das muss sich dringend ändern. Zu guter Letzt will ich auch nicht mehr mit Patienten zu tun haben, die all ihre abstrusen Phantasien auf mich projizieren, nur weil ich weiße Dienstkleidung trage. Weder bin ich Dienstmädchen, noch bezahlte Händchenhalterin, noch Engel in Weiß. Ich bin eine professionelle Pflegefachfrau, ich weiß, was ich tue, und ich weiß, warum ich es tue. Das ist auch bei Patienten weitgehend nicht klar. Daraus entstehen mir zu oft ungut anstrengende Situationen. Und weil wir Pflegenotstand haben, kann ich es mir leisten, mich dem nicht mehr aussetzen zu müssen. Denn etwas Besseres als das habe ich gefunden. Und ich nutze es. „
(Beitragsbild Quelle: GIP)